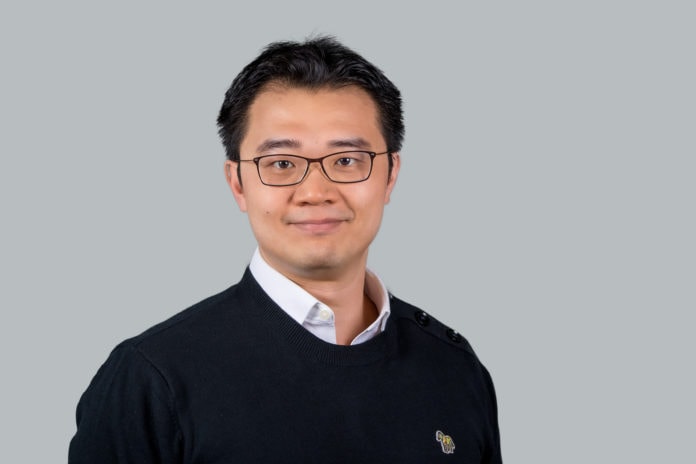Die Frage, welche Rolle Glück und Zufall bei der Personalauswahl spielen, ist das Spezialgebiet von Chengwei Liu. Der Glücksforscher ist überzeugt, dass Unternehmen ihre Diversity voranbringen könnten, wenn sie das Prinzip Zufall geschickt für ihre Auswahlprozesse nutzen.
Dieses Interview erschien am 2. März 2022 auf www.her-career.com.
Herr Liu, Sie sind Professor an der Business School ESMT in Berlin. Haben Sie das Ihren Kompetenzen und guten Leistung zu verdanken oder ist das nur Glück?
Eine Kombination aus beidem vermutlich. Natürlich würde ich gerne glauben, dass man mich eingestellt hat, weil ich der beste Kandidat von allen war. Aber das ist unwahrscheinlich. Für eine solche Stelle kommen mehrere sehr gute Kandidaten auf die Shortlist. Vielleicht hatte ich Glück oder einen guten Tag, als ich den Bewerbungsvortrag halten musste. Oder meine Konkurrenten hatten Pech. Was für meine Leistung spricht: Während alle meine Kolleg:innen sich auf Standardthemen der Unternehmensstrategie fokussierten, habe ich mich schon früh bewusst anders positioniert. Ich habe beschlossen, das Thema Glück und Zufall in der Karriere zu untersuchen. Das war anfangs gar nicht so einfach. Ich musste erst Möglichkeiten finden, den Zufall zu erforschen. Aber es ist mir gelungen und inzwischen zu meiner Forschungsidentität geworden.
Dass Menschen mit anderen Fähigkeiten mehr Chancen in Spitzenpositionen der Wirtschaft erlangen, ist aber nicht garantiert. Menschen neigen bekanntermaßen dazu, Kandidat:innen zu bevorzugen, die ihnen ähneln…
Das stimmt. Die Forschung zeigt, dass Andersartigkeit andere verwirren kann. Die Gefahr ist groß, missverstanden zu werden. Die andere Sichtweise kann verletzten, so dass sich Menschen dagegen wehren. Es geht also darum, ein Gleichgewicht zu finden. Man muss so unterschiedlich sein, wie es legitimerweise möglich ist. Das ist es, was einen „smart Contrarian“ ausmacht.
„Vielfalt bringt in der Produktentwicklung oder bei wissenschaftlichen Entdeckungen oft den Durchbruch“
Wie findet man heraus, wie weit man mit der Andersartigkeit gehen sollte, um der eigenen Karriere nicht zu schaden?
Eine der Lektionen ist, dass man den Erfolg vergessen kann, wenn man genauso agiert wie die Wettbewerber:innen. Doch wenn man anders ist als die Mehrheit, heißt das in der Regel, dass man unrecht hat. Die Frage ist also, wie man sich von der Mehrheit unterscheidet und trotzdem recht hat. Man muss wie ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin untersuchen, ob man die eigene konträre Meinung untermauern kann. Dabei lernt man systematisch anders zu denken. Man muss verschiedene Wechselwirkungen bedenken. Manchmal hat man eine brillante Idee, aber sie löst bei der Zielgruppe Angst vor Veränderung aus oder Investor:innen sehen mehr Risiken als Chancen. Wir sollten prüfen, ob sich die Hindernisse beseitigen lassen. Wenn nicht, gilt es abzuwarten, ob der richtige Moment dafür kommt. Sonst ist die Gefahr groß zu scheitern. All das versucht ein „smart Contrarian“ vorauszusehen.
Die Wertschätzung für solche Freigeister hält sich in Unternehmen bislang eher in Grenzen. Was haben Unternehmen davon, wenn Menschen anders denken?
Wenn wir über komplizierte Probleme nachdenken, brauchen wir nicht die beste Person, sondern eine gemeinschaftliche Vielfalt. Ein vielfältiges Team hat ein sehr reichhaltiges Repertoire, so dass es versteht, wie man Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln angehen kann. Doch Menschen, die nicht in der Mehrheit sind, werden in der Regel bei der Besetzung benachteiligt – also Frauen in Führung, aber auch andere nicht-stereotype Kandidat:innen für eine Unternehmenskultur. In einer Welt, die sich stark verändert, werden divers aufgestellte Unternehmen auf Dauer erfolgreicher sein, aber das dauert seine Zeit. In wirklich diversen Teams sind glückliche Entdeckungen wahrscheinlicher, sogenannte Serendipity-Momente. Man kann nicht voraussehen, was bei einer bestimmten Konstellation herauskommt. Aber Vielfalt bringt in der Produktentwicklung oder bei wissenschaftlichen Entdeckungen oft den Durchbruch.
„Diversity ist auch eine Frage der Gerechtigkeit.“
Wie divers sollten Teams zusammengestellt sein – in Bezug auf Gender oder verschiedene Sichtweisen, damit solche Serendipity-Momente wirklich wahrscheinlicher werden?
Wenn es darum geht, Geschäftsprobleme zu lösen und Vielfalt einzubeziehen, kommt es vor allem auf unterschiedlichen Denkweisen an. Es kann sein, dass ein reines Männerteam dieses Kriterium erfüllt. Da kommt mir der Netflix Prize in den Sinn: Das Unternehmen startete 2006 einen Crowdsourcing-Wettbewerb, um seine Empfehlungsmaschine zu verbessern. Nach drei Jahren gewann ein reines Männer-Team, allerdings waren die Teammitglieder unterschiedlicher Herkunft. Sie hatten eine gewisse Vielfalt in der Art und Weise, das Problem zu betrachten. Wenn ein Unternehmen aber heute rein männliche Teams aufstellt, dann kann es sich harter Kritik aussetzen, auch wenn die Vielfalt im Team eigentlich hoch ist. Das hat damit zu tun, dass nicht nur die Kreativität zählt. Diversity ist auch eine Frage der Gerechtigkeit.
Welchen Aspekt sollten Unternehmen Ihrer Meinung nach in den Vordergrund stellen – Gerechtigkeit oder Innovationskraft?
Mir geht es darum, auf die Schwierigkeit hinzuweisen. Und die Verantwortung, die Unternehmen den Teams gegenüber haben. Sie sollten sie vor Kritik schützen. Ihnen sollte bewusst sein, welchen Zweck sie mit Diversity verfolgen. Häufig geht es nicht um kognitive Vielfalt, sondern darum rassistische und geschlechtsspezifische Vorurteile zu bekämpfen und Chancengleichheit zu schaffen. Wenn Frauen und Minderheiten die gleichen Ausbildungschancen hätten wie Menschen, die im Moment aufgrund unserer sozioökonomischen Geschichte im Vorteil sind, könnten sie in Zukunft auch mehr berufliche Chancen haben. Die Herausforderung besteht also darin, dass eine Firma versteht, was genau sie erreichen will. Geht es um die Lösung eines sozialen Problems unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit? Oder möchte sie mit Vielfalt komplizierte Geschäftsprobleme lösen?
Vermutlich wäre es dann auch sinnvoll, nach Bereichen zu differenzieren, wo es mehr auf das eine oder das andere ankommt. Sind HR-Abteilungen dazu überhaupt in der Lage? Ihre Systeme, Strukturen und Prozesse sollten ja möglichst für alle gleich sein?
Das ist definitiv eine Hürde. Es ist fast ausgeschlossen, dass HR rein männliche Teams erlaubt. Unternehmen wollen Vielfalt nach außen sichtbar abbilden. Das hat auch mit ESG-Kriterien zu tun – Diversity spielt bei dem S, den guten Arbeitsbedingungen, eine Rolle. Das führt oft zu Greenwashing und einer Menge Buchhaltungsübungen, wie viele Männer und Frauen in bestimmten Bereichen vertreten sind. Ein solchen Zwang kann unbeabsichtigte Folgen haben, nämlich zum Beispiel eben, dass man glückliche Zufälle in der Produktentwicklung verhindert. Das ist ein echtes Dilemma. Ich sage nicht, was hier richtig und was falsch ist. Nur: Unternehmen müssen sich darüber im Klaren sein, dass eine starre Politik in die eine Richtung Türen in die andere verschließen kann.
„Man braucht mindestens ein Drittel Vertreter:innen einer Minderheit, damit sie angesichts der dominanten Gruppe nicht das Gefühl hat, ihr Verhalten anpassen zu müssen.“
Eine weitere Ausrichtung von Diversity besteht darin, dass Menschen sich, egal welches Geschlecht und welchen Background sie haben, in ihrer Individualität wertgeschätzt fühlen. Was heißt das für die Zusammensetzung von Teams?
Natürlich bringt es nichts, wenn man Frauen nur aufgrund ihres Geschlechts einstellt. Es geht darum, ein integratives Umfeld zu schaffen, in dem Frauen oder kontra-stereotype Kandidaten:innen langfristig glänzen können. Viele Unternehmen behaupten, dass sie ein solches Umfeld bieten können, aber den wenigsten gelingt es tatsächlich. Denn das erfordert eine Menge Investitionen und Unterstützung seitens der Mitarbeitenden. Ein weiterer Faktor ist die psychologische Sicherheit. Manchmal entsteht dieses integrative Umfeld erst, wenn eine Minderheit nicht mehr in der Minderheit ist, zum Beispiel wenn nicht nur eine Frau im Team ist. Da muss man den Schwelleneffekt betrachten. Eine Daumenregel lautet, dass man mindestens ein Drittel Vertreter:innen einer Minderheit braucht, damit sie angesichts der dominanten Gruppe nicht das Gefühl hat, ihr Verhalten anpassen zu müssen. In den USA wird deshalb beispielsweise positive Diskriminierung implementiert. Eine aktuelle Längsschnittstudie zeigt auch, dass es oft einen Schritt vor geht und zwei zurück. Wenn Frauen eingestellt werden, aber als einzige unter Männern, werden sie oft nicht befördert, weil Kollegen sie nicht wirklich unterstützen. Sie werden zwar nicht explizit diskriminiert, aber die Mehrheit kann die Minderheit dennoch sabotieren.
Kommen wir zu Ihrem persönlichen Forschungsfeld: Glück und Zufall. Sie sagen, viele Top-Manager:innen unterschätzen die Macht des Glücks. Welche Rolle spielt das?
Bei der Auswahl von Kandidat:innen konzentriert man sich oft auf die Besten. Doch gerade im Top-Management gibt nicht die überragende Kompetenz den Ausschlag. Bedeutsamer ist, dass man einem gewissen Stereotyp entspricht, eine hohe Risikobereitschaft hat oder einfach nur Glück. Das ist extrem gefährlich. Denn diese Personen bekommen eine Menge Macht, Status, Benefits und Boni. Das stärkt ihr Ego und Selbstvertrauen, obwohl das oft gar nicht gerechtfertigt ist. Das kann nachhaltige Leistung von Unternehmen verhindern. Glück ist der am meisten unterschätzte Faktor. Dabei wächst die Bedeutung, je höher man in der Hierarchieebene aufsteigt. Das hat mit dem Paradoxon des Könnens zu tun.
„Es geht oft einfach darum, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Doch unsere Vergütungssysteme sprechen eine andere Sprache.“
Das müssen Sie erklären: Was ist das Paradoxon des Könnens?
Das Phänomen lässt sich bei Profisportler:innen beobachten, aber auch in den Auswahlprozessen von Manager:innen. Wenn es um eine Einstiegsstelle geht, haben Sie viele Bewerber:innen mit einem breiten Spektrum an Kompetenzen. Die Personen gehen durch ein Assessment-Center und müssen einen gewissen Schwellenwert erreichen. Die Überlebenden dieser Auswahlrunden sind im Sinne des Unternehmens, wie es Können definiert hat, alle sehr gut. Durch die einheitliche Bewertungsskala kommt es zu einem Nebeneffekt: Die verbliebenen Bewerber:innen werden sich in ihren Fähigkeiten und auch in ihren Merkmalen in Bezug auf Geschlecht und demografischen Hintergrund immer ähnlicher. Die Unterschiede zwischen ihnen sind winzig. Wenn jeder in einer bestimmten Sache besser wird, spielt das Glück bei der Auswahl also eine größere Rolle. Top-Manager halten sich für besser als sie eigentlich sind.
Wie lassen sich dann die enormen Leistungsunterschiede zwischen verschiedenen Unternehmen erklären?
Es geht oft einfach darum, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, Glück mit den Wechselkursen zu haben oder das Glück, dass keine Naturkatastrophen passieren. Das entzieht sich der Kontrolle von Manager:innen. Doch unsere Vergütungssysteme und die Statussymbole der Macht sprechen eine andere Sprache. Das schafft eine Unternehmenskultur, in der die Überlebenden an der Spitze, meist Männer, eine fast unüberwindbare Barriere schaffen.
Sie meinen also, wenn man stärker das Glück walten ließe, könnte man Überheblichkeit im Management, aber auch eine stereotype Voreingenommenheit bezüglich Geschlecht, sexueller Orientierung oder Herkunft eindämmen? Wo müsste man da ansetzen?
Zum einen kann man versuchen, diese stereotype Aneinanderreihung weniger auffällig zu machen. Dabei kann zum Beispiel eine CV-Blind-Policy helfen, also dass Unternehmen bestimmte Informationen in Bewerbungsunterlagen ausblenden – Merkmale wie Geschlecht, ethnische Herkunft, Alter oder Wohnort. In Frankreich, wo die rassistische Voreingenommenheit und die Segregation sehr stark ausgeprägt sind, verrät zum Beispiel die Postleitzahl von Bewerber:innen in gewissem Maße ihren sozioökonomischen Status. Wenn diese Information ausgeblendet wird, entscheidet man eher auf der Grundlage der Verdienste. Außerdem gibt es Verhaltenstechniken, die im Vorstellungsgespräch oder im Assessment-Center eingesetzt werden können, um die wirklichen Verdienste zum Vorschein kommen zu lassen. Doch je länger ein Unternehmen besteht und desto festgefahrener die Unternehmenskultur ist, desto schwerer wird sie sich damit tun. Jüngere Firmen und Start-ups haben hier einen Wettbewerbsvorteil.
Margaret Osterloh und ihre Forscherkollegen empfehlen, dass die Rekrutierung von Führungskräften dem Zufallsprinzip folgen sollte. In einem Experiment konnten sie zeigen, dass durch das Los ausgewählten Personen weniger wahrscheinlich in eine Art Selbstüberschätzungsfalle tappen. Was halten Sie davon?
Das ist ein grandioses Experiment, das mit meinen Ideen und meiner Forschung zu tun hat. Die Zufallsauswahl hat eine lange Tradition in menschlichen Gesellschaften. Schon im antiken Athen und in Venedig wählte man Führungspersonen durch Losglück. Blindes Glück kann vor allem die Voreingenommenheit gegenüber bestimmten Personen reduzieren. Außerdem spart man mit einer Zufallsauswahl sehr viel Zeit und Geld. Auswahlexpert:innen müssten dann nur noch die schlechten Bewerbungen herausfischen, bei denen das nötige Skilllevel nicht vorhanden ist. Aber ein solches Vorgehen setzt sich in der Praxis bisher nicht durch. Den meisten Personalverantwortlichen ist die Idee zu wild. Vermutlich ist da auch die Wirtschaftsausbildung daran schuld, die schon Studierenden das Gefühl vermittelt, sie müssten aufgrund irgendeiner rationalen Logik entscheiden. Natürlich ist dies auf den Einstiegsebenen sehr wichtig. Aber die Zufallsauswahl kann für höhere Auswahlstufen immer wichtiger werden, wenn es darum geht, Vorurteile zu überwinden. Die Zufallsauswahl garantiert nicht die beste Lösung, aber sie übertrifft oft Lösungen, die durch Voreingenommenheit beeinträchtigt sind.
Solange sich das nicht durchsetzt, was können Frauen selbst tun, um ihrem Glück bei der Karriere etwas nachzuhelfen?
Es kommt darauf an, wo sie in ihrer Karriere stehen und welchen Weg sie einschlagen möchten. Beim Einstieg in den Beruf zählen vor allem die erforderlichen Kompetenzen, um voranzukommen. In Start-ups ist es wichtiger, Generalist:in zu sein und in verschiedenen Fähigkeiten zu glänzen. In großen Unternehmen muss man sich stärker spezialisieren. Am Ende gilt es, ein gutes Gleichgewicht zwischen Spezial- und Allgemeinkenntnissen zu haben. Die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten gilt es gut zu steuern, sonst kann man leicht in die sogenannte Kompetenzfalle tappen: Dass man nur in einer Sache gut ist und die Kompetenzen für die nächste Karrierestufe fehlen. Dabei hilft das Prinzip der zweiten Kurve: Wir sollten eine zweite Kompetenzkurve entwickeln, bevor wir mit der ersten den Gipfel erreicht haben. Das Problem dabei: Wenn wir in einer bestimmten Sache einen Expertenstatus erlangen, fühlen wir uns gut. Es kostet Überwindung etwas Neues zu probieren, was für uns anfangs schwierig ist und Frustrationen mit sich bringen kann.
Und wenn man es schon in die obersten Führungsebenen geschafft hat, dann kommt der Zufall ins Spiel. Kann man den Zufall aktiv zu den eigenen Gunsten nutzten oder ist man ihm einfach ausgeliefert?
Am Ende tun die Wettbewerber:innen in Spitzenjobs auch viel für ihre Kompetenzentwicklung. Auch sie haben an der zweiten Kurve gearbeitet und dann hängt in der Tat viel vom Glück ab. Das Einzige, was wir für unser Glück tun können, ist, nicht aufzugeben. Es gibt eine interessante Studie, die zeigt, dass Männer und Frauen unterschiedlich mit Niederlagen bei der Beförderung umgehen. Wenn Männer abgelehnt werden, schieben sie das Scheitern auf die anderen und suchen die Ursachen nicht bei sich selbst. Frauen hingegen glauben, sie sind nicht gut genug. Das führt dazu, dass sie es bei der nächsten Gelegenheit nicht mehr versuchen. Ich empfehle allen Frauen, sich von Absagen nicht entmutigen zu lassen. Das ist wie beim Lottospielen: Auch wenn man verliert, investiert man weiter. Wer weiter Lose kauft, erhöht die Gewinnchancen.
Am 17. März sprach Prof. Chengwei Liu in einem Online-Vortrag der herCAREER über das Thema „Luck or performance? What really matters in a leadership career“. Der Vortrag kann in der Mediathek nachgeschaut werden.
Über Chengwei Liu
Der in Taiwan ausgebildete Wirtschaftswissenschaftler Chengwei Liu (Ph.D., Cambridge) ist außerordentlicher Professor für Strategie und Verhaltenswissenschaften und Fakultätsleiter des Global Online MBA-Programms an der European School of Management and Technology (ESMT Berlin). Er hatte Forschungs- und Lehraufträge in Cambridge, Oxford, MIT, Wharton, NYU, INSEAD, der National University of Singapore, der Peking University und Warwick und wurde mit mehr als 20 Forschungs- und Lehrpreisen ausgezeichnet. Thinkers50 nennt Chengwei einen führenden Management-Denker und Poets&Quants bezeichnet ihn als „Top 40 under 40 MBA Professor“. Chengweis Buch „Luck: A key idea for business and society“ (Glück: Eine Schlüsselidee für Wirtschaft und Gesellschaft) fasst seine Forschungen darüber zusammen, wie man Glück im Sport, bei Investitionen und in der Wirtschaft quantifizieren und strategisch nutzen kann. Er beschreibt die Auswirkungen auf die Beurteilung von Leistung und sozialer Ungleichheit. Seine aktuelle Forschung konzentriert sich darauf, wie Unternehmen im Zeitalter von Algorithmen mit Vielfalt umgehen sollten und wie man ein „smart Contrarian“ wird.