Haben Sie die Zukunft im Blick?
Neue Technologien und Künstliche Intelligenz verändern unseren Arbeitsmarkt rasant. Für Frauen birgt das Risiken – aber auch viele Chancen.
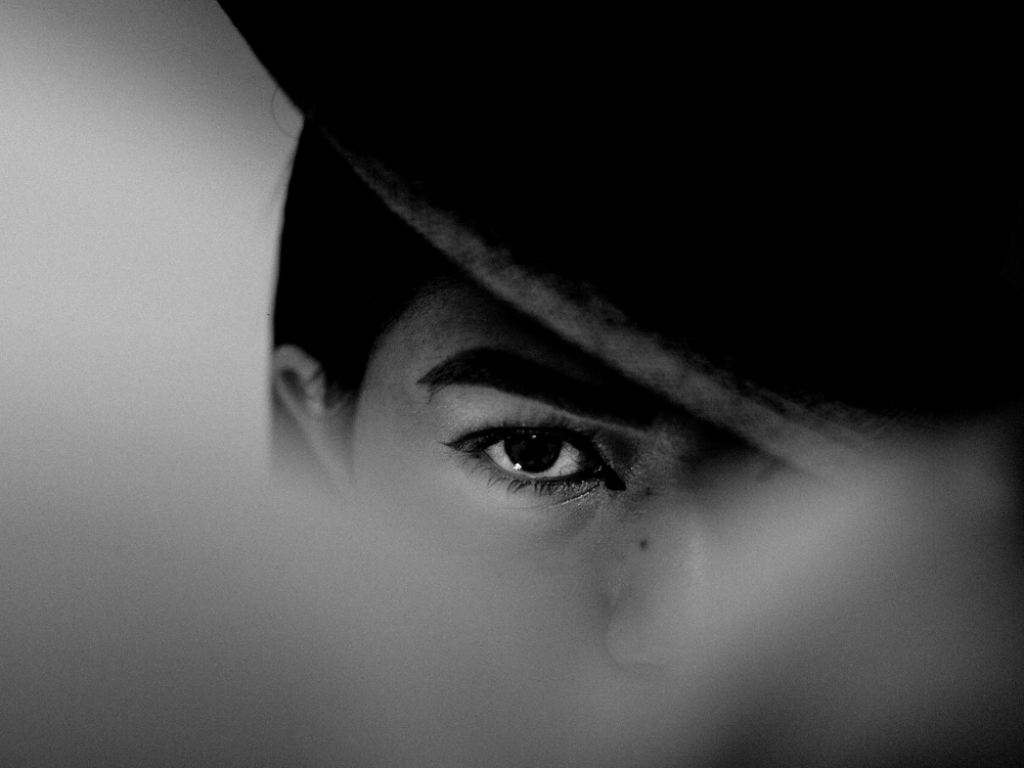
Text: Elisabeth Krainer
Das Stichwort KI entfacht aktuell die wohl kürzeste Zündschnur der Welt: Sofort ergießen sich Utopien neben Dystopien, von einer Welt der Freizeit bis zur Herrschaftsübernahme von Robotern ist die Rede. Egal, ob man positiv oder negativ darauf blickt, eins ist klar: Die Digitalisierung hat gerade erst Anlauf genommen. Die Wirtschaft wird sich so stark verändern wie zuletzt in Zeiten der Industrialisierung. Das birgt große Chancen – neue Tätigkeitsfelder, neue Karrierepfade, mehr Produktivität.
Diese Chancen sind jedoch nicht für alle gleichermaßen greifbar. Das Ungleichgewicht zeigt sich in aktuellen Zahlen: Eine Analyse der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hat herausgefunden, dass vor allem Berufe mit bürokratischen, administrativen und standardisierten Aufgabenprofilen stark durch KI verändert oder wegfallen werden. Das sind Berufe, die mehrheitlich Frauen ausüben. Zum Beispiel in der Verwaltung, Buchhaltung, Sekretariat oder im Kund*innendienst. Laut ILO arbeiten weltweit etwa 4,7 Prozent aller erwerbstätigen Frauen in den betroffenen Branchen. Bei Männern sind es etwa 2,4 Prozent. In wirtschaftsstarken Ländern liegt der Anteil sogar noch höher: 9,6 Prozent bei Frauen, 3,5 Prozent bei Männern. KI hat also nicht nur das Potenzial, den Arbeitsmarkt zu revolutionieren – sie könnte auch zu noch mehr Geschlechterungleichheit führen.
Digital abgehängt: Warum Frauen zuerst betroffen sind
Die krisensicheren Jobs entstehen im Kontext der Digitalisierung. Dort sind Frauen unterrepräsentiert. Der Thinktank Interface hat in einer Studie aus 2024 herausgefunden, dass die Gender-Gap in der KI-Branche in Deutschland und Österreich besonders tief ist: In Deutschland liegt der Frauenanteil an KI-Talenten bei etwa 20 Prozent, in Österreich bei rund 19. Damit sind sie Schlusslicht in Europa.
Ein Grund: fehlende weibliche Vorbilder. Dass Berufe im KI-Bereich deutlich häufiger mit Männern besetzt sind, liegt unter anderem daran, dass Mädchen und jungen Frauen bis heute geringere Technik-Skills nachgesagt werden: MINT-Berufe, also Jobs in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, seien nichts für sie. Immer noch steckt das Klischee der zu emotionalen Frau in den Köpfen vieler – so werden Soft Skills zum Handicap und IT-Skills zum kategorischen Mangel.
Das zeigt sich in Studien, die das Selbstverständnis im Umgang mit KI von Männern und Frauen untersuchen: Der Jahresreport aus 2024 der deutschen Initiative Chef:innensache zeigt, dass 43 Prozent der befragten Männer ihre KI-Skills als gut einschätzen. Dagegen nur 30 Prozent der Frauen.
„Frauen müssen mit am (Programmier-) Tisch sitzen.“
Eva-Maria Holzleitner, österreichische Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Es ist also, als wären Männer beim KI-Wettrennen direkt mit großem Vorsprung an den Start gegangen. Die Lücke, die Frauen mit individuellen Fortbildungen, Lehre oder ganzen Studiengängen auffüllen müssten, ist groß. Und sie wird größer, wenn man auf die Rahmenbedingungen blickt, die Frauen während ihrer Berufslaufbahnen vorfinden: Viele weibliche Erwerbsbiographien sind von Pflegezeiten, Elternzeit und Teilzeit-Modellen wegen fehlender Kinderbetreuung geprägt. KI entwickelt sich aber rasend schnell. Verpasst man also Monate oder Jahre, sinkt der Wert am Arbeitsmarkt. Ständig am Ball zu bleiben, ist für viele eine große Herausforderung.
Laut einer Umfrage von AWS Amazon Web Services in den USA geben 35 Prozent der befragten Frauen an, nicht zu wissen, wo sie anfangen und auf welche Skills sie sich bei KI-Fortbildung fokussieren sollen. 26 Prozent haben laut der Umfrage keine Zeit für zusätzliche Ausbildungen. Das ist keine Frage der Motivation, sondern eine der Strukturen, in denen Frauen sich bewegen: In einer Arbeitswelt, die von Männern für Männer gemacht ist und auf der unbezahlten Care-Arbeit von Frauen basiert.
Smart Hilfe, wo die Last am größten ist
Soweit, so dystopisch. Sollte die Technologie aber nicht dazu da sein, uns die Arbeiten abzunehmen, die uns den letzten Nerv rauben? Der Meinung ist auch Start-up-Gründerin und KI-Expertin Rosaria Di Donna. Sie war Managerin bei Microsoft, hatte so schon früh Berührungspunkte mit KI. Im Arbeitskontext erleichterte ihr die Technologie viele Steps – Mails korrigieren, Tabellen füllen, Meetings transkribieren. Im Privaten jedoch nicht. Als zweifache Mutter weiß Di Donna, welche Last auf Frauen liegt, die das Familienleben nebenbei organisieren.
Sie will mit KI Raum schaffen für das, worum es beim Menschsein geht – erleben, fühlen, kreativ sein. Deshalb hat sie das Start-up familymind.ai gegründet. Eine App, die Familien unterstützt, den Mental Load zu organisieren. Also zum Beispiel Kalender abzustimmen, Betreuungen beim nächsten Kita-Streik zu koordinieren, den Flyer für die Schul-Party zu gestalten. Rosaria Di Donna setzt mit der Technologie dort an, wo die Last am größten ist: Im Alltag, den Frauen meist (fast) alleine wuppen und so keine Ressourcen für Bücher, Podcasts oder Kurse übrig haben. Also genau dort, wo Ungleichheit verschärft wird. Familymind.ai soll alle Famillienmitglieder dazu befähigen, Tasks zu übernehmen. „Ich will Menschen ermutigen, die Technologie für sich zu nutzen und sie nicht ausschließlich als Bedrohung zu sehen“, sagt Di Donna. „So gewinnen User*innen nicht nur mehr Zeit für das Wesentliche, sie lernen auch, wie KI funktioniert und welche Möglichkeiten die Technologie uns gibt.“
KI-Bildung ist für die Expertin entscheidend, um alle abzuholen. Nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch auf unternehmerischer: „Zum einen haben wir am Arbeitsmarkt ein Problem mit fehlenden Fachkräften. Zum anderen nutzen Unternehmen das Potenzial bisher nicht, das Frauen und Mütter mitbringen“, so Di Donna. Das gehe nur mit aktiver Förderung von Arbeitgeber*innen, etwa während und nach der Elternzeit, aber auch mit einer individuellen Offenheit, die KI-Einsteiger*innen mitbringen sollten.
Für Frauen, die sich aktiv weiterbilden wollen, empfiehlt Di Donna kostenfreie Online-Kurse von Google, der Universität Harvard oder des MIT Massachusetts Institute of Technology. „Der Schlüssel ist: einfach machen“. Keine Angst vor der Technologie zu haben, rumzuspielen, sich mit ChatGPT einen eigenen Chatbot basteln. „Der Vorteil an den rasend schnellen Entwicklungen ist, dass es dadurch auch immer mehr easy Zugang zur Technologie gibt. Man muss heute keine Developer-Skills mehr haben, um einen Bot oder eine App zu bauen“, sagt Di Donna. Entwicklungen wie Vibe-Coding (User*innen beschreiben in natürlicher Sprache, wie die fertige Anwendung aussehen soll, KI schreibt den Code) ermöglichen einen niedrigschwelligen Einstieg.
Wer Support vom Unternehmen sucht, soll laut Di Donna Vorgesetzte in die Verantwortung ziehen und aktiv danach fragen – denn am Ende profitieren alle davon, wenn Arbeitnehmer*innen eine solide Basis in Sachen Technologie aufbauen.
Auch die Politik wird aktiv
KI kann die Geschlechterungleichheit am Arbeitsmarkt steigern. Ob sich das verhindern lässt, hängt von individueller Offenheit ab, noch viel stärker aber von strukturellen Hürden, die politisch abgebaut werden müssen. Die österreichische Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner sagt dazu: „Im Regierungsprogramm haben wir klar festgehalten, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen, MINT-Berufen sowie in den Bereichen Digitalisierung und KI bringen, halten und unterstützen wollen“.
Sie hält es für wichtig, dass Frauen auch in die Entwicklung einbezogen werden: „Junge Menschen müssen von Anfang an lernen, verantwortungsvoll und kritisch mit KI umzugehen. Gleichzeitig braucht es Erwachsenenbildung, die auch Menschen erreicht, die vielleicht seit Jahren nicht mehr in einem Lernkontext waren“, sagt Holzleitner. Und: „Frauen müssen mit am (Programmier-)Tisch sitzen.“ Denn Technologie spiegelt immer die Lebenswelt derer wider, die sie entwickeln. Je vielfältiger die Teams sind, die KI entwickeln, desto besser werden die Ergebnisse – weniger Klischees, weniger Diskriminierung, mehr Differenziertheit. Und am Ende entscheidet nicht die KI selbst über unsere Zukunft, sondern diejenigen, die sie bauen. Höchste Zeit, ein Wörtchen mitzureden.
Mehr KI & Innovation in der aktuellen Ausgabe
Dieser Artikel erschien zuerst in der sheconomy Printausgabe 4/25 mit dem Schwerpunkt Innovation. Wer tiefer einsteigen möchte, kann das Heft hier bestellen oder abonnieren.





